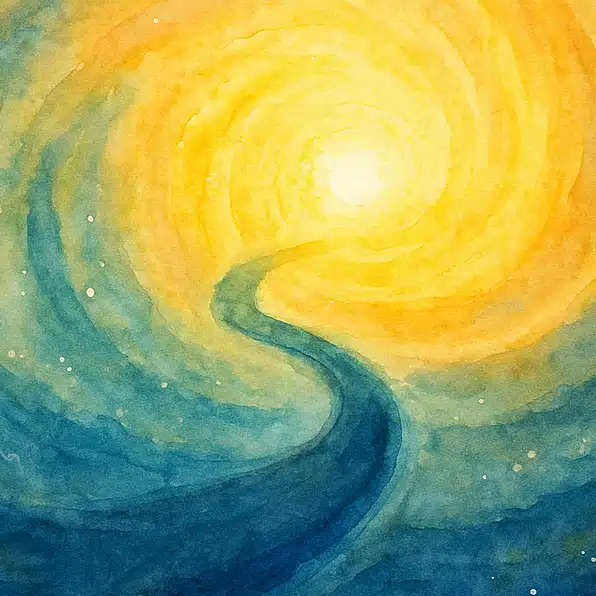In vielen Menschen keimt die Frage auf: Was geschieht spirituell, wenn unser Körper nach dem Tod verbrannt wird? Ist es für die Seele von Bedeutung, ob der Körper dem Feuer oder der Erde übergeben wird? Gerade wer eine Feuerbestattung plant, spürt mitunter Ängste: Wird die Seele durch das Verbrennen verletzt oder am Weitergehen gehindert? Die Antworten darauf fallen je nach religiöser und spiritueller Tradition sehr unterschiedlich aus.
Im Folgenden werfen wir einen umfassenden Blick auf die Sichtweisen verschiedener Glaubensrichtungen – von den Weltreligionen bis hin zu esoterischen Quellen wie den berühmten Readings Edgar Cayces – und beleuchten aus Jenseits-Sicht, ob eine Feuer- oder Erdbestattung “spirituelle Konsequenzen” hat.
- Spirituelle Haltung zur Feuerbestattung im Überblick
- Christentum: Auferstehung des Leibes und Wandel der Bestattungskultur
- Judentum: Der Körper als “Tempel der Seele” und die Unantastbarkeit des Grabes
- Islam: “Gebt die Schöpfung Allahs nicht dem Feuer preis”
- Hinduismus: Feuer als Tor zu Befreiung und Weiterleben
- Buddhismus: Vergänglichkeit des Körpers und Loslösung des Geistes
- Esoterik: Edgar Cayce sowie weitere esoterische Lehrer
- Was bedeutet das für unsere letzte Reise?

Spirituelle Haltung zur Feuerbestattung im Überblick
Zum Einstieg gibt die folgende Übersichtstabelle einen schnellen Vergleich der wichtigsten spirituellen Haltungen zur Feuerbestattung vs. Erdbestattung:
| Tradition | Spirituelle Haltung zur Feuerbestattung | |
|---|---|---|
| Buddhismus | Kremation bevorzugt, da der Körper als vergängliches Gefäß gilt. Die Seele (das Bewusstsein) soll durch die Verbrennung freigegeben werden, um in den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt weiterzuwandern bzw. letztlich Erleuchtung zu finden. In einigen Traditionen wird dennoch einige Tage bis zur Einäscherung gewartet. | |
| Christentum (katholisch, protestantisch) | Glaube an Auferstehung des Körpers, historisch Bevorzugung der Erdbestattung. Seit dem 20. Jh. ist Kremation erlaubt, da sie die Seele nicht beeinträchtigt oder die Auferstehung nicht verhindert. | |
| Christentum (orthodox) | Lehnt Kremation strikt ab. Die Erdbestattung gilt als Ausdruck von Respekt vor dem von Gott geschaffenen Leib; freiwillige Einäscherung wird als Verneinung der leiblichen Auferstehung angesehen. | |
| Esoterik | Generell gilt die Loslösung der Seele vom Körper als entscheidend, nicht die Bestattungsform. Viele Medien und Mystiker betonen, die Seele verlasse den Leib kurz nach dem Tod – dann sei es egal, ob Feuer oder Erde folgt. Edgar Cayce etwa empfahl die Feuerbestattung sogar als “beste” Methode, sofern man etwas Zeit lässt, bis die “Elementarkräfte” sich gelöst haben. Esoterische Richtungen raten oft zu einer Wartezeit (ca. 3 Tage) vor der Kremation und zu Ritualen, um der Seele den Übergang zu erleichtern. | |
| Hinduismus | Feuerbestattung als Ideal. Der Körper ist nur eine Hülle – durch das Verbrennen wird die Seele befreit und von weltlichen Restbindungen gereinigt. Das Feuerritual (Antyesti) erleichtert den Übergang der Seele in die nächste Wiedergeburt oder sogar ins Moksha (Erlösung). | |
| Islam | Verbot der Feuerbestattung (haram). Der Körper muss unversehrt und ehrwürdig bestattet werden (vorgeschriebene Bestattungsriten). Verbrennen gilt als Verstümmelung der von Gott geschaffenen Hülle. Der Glaube an die körperliche Auferweckung spielt mit hinein. | |
| Judentum | Orthodox: strikte Ablehnung der Feuerbestattung – der Körper als “Tempel der Seele” soll unversehrt der Erde übergeben werden, auch wegen des Auferstehungsglaubens. Liberale Gemeinden erlauben Kremation teilweise, betonen aber stets die Würde des Leichnams. |
Nun gehen wir detailliert auf diese Positionen ein – und machen den einen oder anderen Abstecher zu spannenden Überlieferungen.
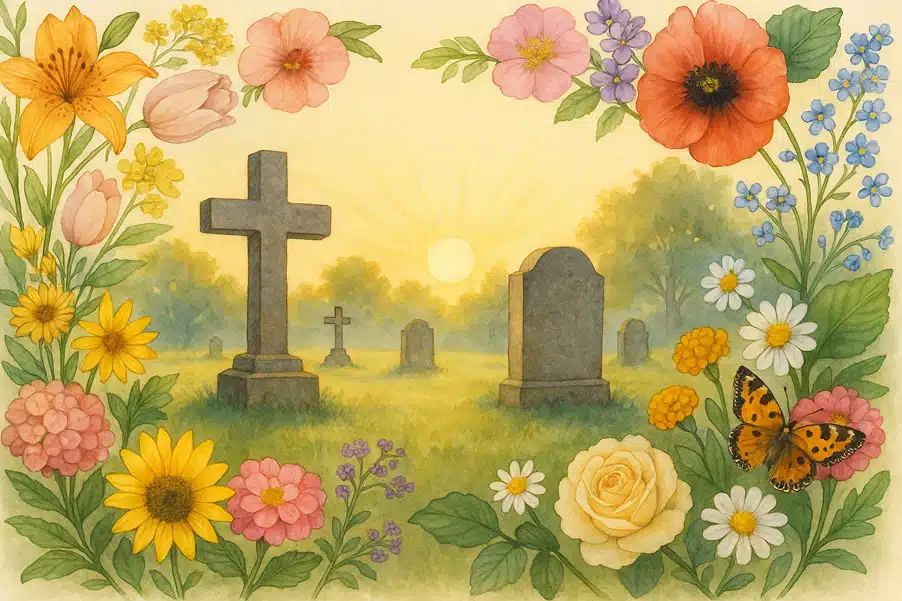
Christentum: Auferstehung des Leibes und Wandel der Bestattungskultur
Die christlichen Kirchen beschäftigten sich lange mit der Frage der richtigen Bestattung. Historisch war die Erdbestattung klar bevorzugt. Der Glaube, dass der Körper am Jüngsten Tag auferstehen werde, ließ viele Christen davor zurückschrecken, den Leib zu verbrennen.
In den ersten Jahrhunderten nach Christus galten Feuerbestattungen sogar als heidnisch: Märtyrerlegenden berichten, dass römische Verfolger die Leichname verbrannten, um die Auferstehung zu vereiteln – was die Christen jedoch als Irrglauben zurückwiesen.
Stattdessen setzte sich das Begräbnis auf geweihtem Boden als Standard durch, verbunden mit der Vorstellung, der “Schlaf” im Grab ende einst mit der Auferweckung des Körpers in Herrlichkeit.
Katholische Kirche zur Einäscherung
Heute hat sich die Haltung in weiten Teilen der christlichen Welt deutlich verändert. Die katholische Kirche erlaubt seit 1963 die Einäscherung unter der Bedingung, dass diese nicht aus einer Ablehnung christlicher Glaubensinhalte (zum Beispiel der Auferstehung) geschieht.
In einem vatikanischen Schreiben von 2016 wird betont, die Kirche habe “keine dogmatischen Einwände” gegen die Kremation, denn die Seele eines Verstorbenen werde dadurch nicht betroffen, noch werde Gottes Macht zur Auferweckung des Leibes geschmälert.
Aus katholischer Sicht überdauert die Seele den Tod unabhängig davon, ob der Körper verbrannt oder beerdigt wird.
Wichtig ist der Kirche allerdings weiterhin ein würdiger Umgang mit den sterblichen Überresten – so sollen die Aschen nicht verstreut oder zuhause aufbewahrt, sondern in geweihter Erde beigesetzt werden.
Die evangelische Kirche zur Feuerbestattung
Auch die evangelischen Kirchen stehen Feuerbestattungen offen gegenüber. In der Regel wird hervorgehoben, dass für Gott beim Jüngsten Gericht keine materiellen Hindernisse bestehen: “Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub” – letztlich kehrt der Körper so oder so zur Erde zurück, während die Seele in Gottes Hand liegt.
Evangelische Theologen betonen aber – ähnlich wie Paulus im Neuen Testament – die Würde des Leibes: Dieser sei “Tempel des Heiligen Geistes” (1. Kor. 6,19) und verdiene einen respektvollen Abschied.
Ob dieser Abschied durch Feuer oder Erde erfolgt, beeinflusst nach heutiger Lehre nicht das Seelenheil.
Oft entscheiden deshalb praktische oder persönliche Gründe: Kosten, Platzmangel auf Friedhöfen oder auch der Wunsch des Verstorbenen. Die Trauerfeiern werden – ob mit Sarg oder Urne – sinngemäß gleich gestaltet, und die Vorstellung, die Seele gehe ins Jenseits ein, bleibt unverändert.
Orthodoxes Christentum: nur Erdbestattung
Im orthodoxen Christentum gilt die Erdbestattung traditionell als einzig zulässige Form der Bestattung. Der Körper des Menschen wird in der orthodoxen Theologie als von Gott geschaffen und als integraler Teil der Person verstanden. Durch die Sakramente – insbesondere die Taufe und die Eucharistie – ist der Leib nach orthodoxem Verständnis geheiligt.
Aus diesem Grund wird es als unangemessen empfunden, den Körper nach dem Tod durch Feuer zu zerstören. Vielmehr soll er in die Erde zurückkehren, „aus der er genommen wurde“, wie es in der Genesis heißt.
Darüber hinaus spielt der Glaube an die leibliche Auferstehung eine wesentliche Rolle. Orthodoxe Theologen betonen, dass der Mensch am Ende der Zeiten mit verklärtem, aber realem Körper wieder aufersteht.
Zwar wird nicht geleugnet, dass Gott auch verbrannte Körper neu erschaffen könnte – aber die freiwillige Zerstörung des Leibes durch Feuer wird als ein Symbol der Verweigerung oder Ablehnung dieses Glaubens verstanden.
Man sieht in der Feuerbestattung eine Verletzung der von Gott verliehenen Würde des Körpers und einen Bruch mit der Tradition der Kirche.
Aus diesen Gründen wird die Feuerbestattung in den orthodoxen Kirchen in der Regel verboten bzw. nur in äußersten Notsituationen (zum Beispiel Epidemien, Naturkatastrophen) geduldet. In vielen orthodoxen Ländern wird Personen, die sich freiwillig für eine Kremation entscheiden, sogar ein kirchliches Begräbnis verweigert.
Anzeige

Judentum: Der Körper als “Tempel der Seele” und die Unantastbarkeit des Grabes
Im Judentum spielt die Ehrfurcht vor dem toten Körper eine herausragende Rolle. Die ablehnende Haltung gegenüber der Verbrennung zeigt sich auch in jüdischen Trauergebeten und Schriften, wo der Körper als “Tempel der Seele” bezeichnet wird.
Traditionelle jüdische Auffassung zur Feuerbestattung
Die traditionelle Auffassung lautet, dass der Leib eines Menschen von Gott geschaffen und daher bis zuletzt mit Respekt zu behandeln ist. Aus diesem Grund ist im orthodoxen Judentum die Feuerbestattung verboten – sie wird als bewusste Zerstörung des Körpers verstanden, was der religiösen Geboten widerspricht.
Stattdessen erfolgt die Beisetzung so bald wie möglich nach dem Tod (meist innerhalb 24 Stunden), direkt in der Erde. Das jüdische Bestattungsritual (Tahara1) umfasst das behutsame Waschen und Ankleiden des Leichnams sowie das Einhüllen in ein schlichtes Leinentuch, bevor er in einem einfachen Holzsarg ins Grab gelegt wird.
Der Friedhof selbst gilt als heiliger Ort: Ein jüdisches Grab darf nach der Halacha2 niemals eingeebnet oder neu belegt werden, da man es dem Frieden der Toten überlässt. Diese Unantastbarkeit des Grabes hängt eng mit dem Glauben an die spätere Auferstehung der Toten zusammen – das Grab soll bereitstehen, wenn am Ende der Tage die Körper wiederbelebt werden.
Man glaubt zwar, dass die Neshamah (Seele) nach dem Tod zu Gott zurückkehrt, jedoch bleibt dem Körper eine gewisse spirituelle Bedeutung.
Einige mystische Traditionen (Kabbala) lehren, dass ein Funke der Seele sogar bis zur vollständigen Verwesung im Leib verweilen könnte – ein weiterer Grund, warum künstliche Beschleunigung durch Feuer als problematisch angesehen wird.
Moderne jüdische Auffassung zur Feuerbestattung
In der modernen jüdischen Welt gibt es allerdings unterschiedliche Ansichten. Liberale oder reformierte Gemeinden zeigen sich teils offener gegenüber der Kremation, vor allem wenn gesetzliche Notwendigkeiten oder persönliche Wünsche dies erfordern.
In Israel etwa kam es während der COVID-Pandemie zu Diskussionen darüber, ob im Notfall kremiert werden dürfte. Offiziell halten aber auch progressive Strömungen daran fest, dass die Erdbestattung der vorzugswürdige Weg ist.
Viele Rabbiner versuchen, selbst bei Feuerbestattungen eine Form der traditionellen Würde zu wahren – zum Beispiel indem die Asche anschließend in einem jüdischen Friedhof beigesetzt wird, um dem Verstorbenen doch noch “ewige Ruhe” im Boden zu geben.
Für strenggläubige Juden ist die Vorstellung, der Körper könnte verbrannt werden, oft auch emotional schwer erträglich – nicht zuletzt wegen der grausamen Erfahrungen im Holocaust, wo Millionen jüdischer Körper in den Krematorien der Nazis vernichtet wurden.
Die Seele jedoch, so glauben sie fest, entzieht sich menschlichem Zugriff: Sie geht zurück zu ihrem Schöpfer, unbeschadet von irdischen Ereignissen.
Anzeige

Islam: “Gebt die Schöpfung Allahs nicht dem Feuer preis”
In der islamischen Tradition gibt es kaum Spielraum: Die Feuerbestattung ist strikt untersagt. Nach islamischem Verständnis verfügt allein Allah über Leben und Tod – und der Mensch hat den Leib, den Allah ihm anvertraut hat, nach dem Tod unversehrt der Erde zurückzugeben.
Kremation wird im Islam als haram (religiös verboten) eingestuft und sogar als najis (unrein) betrachtet.
Gläubige Muslime und Musliminnen dürfen weder an einer Verbrennung teilnehmen, noch dieser zustimmen oder beiwohnen. Stattdessen schreiben die religiösen Regeln (Scharia) eine schnelle Körperbestattung vor: Idealerweise innerhalb von 24 Stunden soll der bzw. die Tote begraben werden, gewöhnlich ohne Sarg, nur in ein Leinentuch gehüllt, das Gesicht nach Mekka ausgerichtet.
Warum diese strikte Ablehnung der Einäscherung? Zum einen betont der Islam – ähnlich wie das Judentum – den hohen Wert des menschlichen Körpers. Der Prophet Mohammed lehrte sinngemäß, das Brechen eines toten Menschenknochens sei so sündhaft, als breche man den Knochen eines Lebenden.
Das Verbrennen eines Körpers käme einer Entweihung gleich, einem Akt der Gewalt gegen die Schöpfung.
Zum anderen spielt der Glaube an die leibliche Auferstehung am Jüngsten Tag auch im Islam eine Rolle. In islamischer Überlieferung heißt es etwa, dass beim Verwesungsprozess ein kleines Knochenteil – als Steißbein oder “Schwanzbein” bezeichnet – erhalten bleibe, aus dem Allah den Körper am Ende der Zeiten neu erschaffen wird.
Diese Vorstellung führt dazu, dass manche Gelehrte die Kremation als Eingriff sehen, der die Auferstehung scheinbar erschwert, weil er auch dieses letzte Körperteil vernichtet. Zwar wird theologisch eingeräumt, dass Allah selbstverständlich allmächtig ist und auch aus Asche einen Menschen auferwecken kann.
Doch bewusst soll der Gläubige eine solche Zerstörung nicht herbeiführen, sondern den Körper in Gottes Obhut lassen – im Vertrauen darauf, dass Allah ihn so wiedererweckt, wie Er es will.
Neben diesen Glaubensgründen gibt es auch eine sehr praktische Komponente: Im Islam existieren genaue Regeln für die Bestattung, darunter rituelle Waschungen, das Einhüllen in ein weißes Tuch und das gemeinschaftliche Totengebet.
All diese Rituale setzen einen unverbrannten Körper voraus. Die Vorstellung, all diese Traditionen zu umgehen und den Leib dem Feuer zu übergeben, widerspricht dem Selbstverständnis der islamischen Gemeinschaft zutiefst. Selbst in Ausnahmefällen – etwa bei Seuchen – wird Kremation nur zögerlich erwogen, und wenn, dann braucht es dazu eine ausdrückliche fatwa (Rechtsgutachten von autoritären Gelehrten).
Für Muslime gilt also zusammenfassend: Die Seele verlässt den Körper beim Tod (sie tritt ein in das Barzakh, die Zwischenwelt bis zum Jüngsten Gericht), doch man behandelt den verlassenen Körper weiterhin sorgsam aus Gehorsam gegenüber Allah.
Spirituell gesehen vertrauen sie darauf, dass die Seele ihren Weg zu Gott findet, unabhängig von den Umständen der Bestattung – aber aus Achtung vor Gottes Geboten wird der Körper niemals verbrannt.
Sollte ein Muslim dennoch kremiert werden (zum Beispiel gegen seinen Willen oder durch ungünstige Umstände), so glaubt man, dass dies seine letztendliche Auferstehung und sein Schicksal im Jenseits nicht verhindert – es wird jedoch als sündhafter Akt betrachtet, für den nicht der Verstorbene, sondern die Verantwortlichen Rechenschaft schulden.

Hinduismus: Feuer als Tor zu Befreiung und Weiterleben
Im Hinduismus ist die Feuerbestattung nicht nur erlaubt, sondern sogar die bevorzugte und heilige Form der Bestattung. Sie wird als Antyesti (wörtlich „letztes Opfer“) bezeichnet – eine der wichtigen Sakramente im Lebenszyklus eines Hindus.
Dahinter steht folgende Sichtweise: Der physische Körper ist nach hinduistischer Lehre nur die äußere Hülle, die der unsterblichen Seele (Atman) für die Dauer eines Lebens als Gefäß dient. Stirbt ein Mensch, so verlässt der Atman den Körper und wandert weiter.
Um diesen Übergang zu erleichtern und alle Bindungen zu lösen, wird der Körper dem reinigenden Element Feuer übergeben.
Man sagt, die Verbrennung befreit die Seele von ihrer irdischen Existenz und hilft ihr, die feinstofflichen Verbindungen zur vergangenen Inkarnation abzustreifen.
In der Praxis sind hinduistische Kremationen reich an Riten und Symbolik. Die Familie – insbesondere der älteste Sohn des bzw. der Verstorbenen – spielt eine zentrale Rolle: Er entzündet den Scheiterhaufen, der zumeist unter freiem Himmel brennt. Vorher wird der Leichnam mit Ölen gesalbt, in Tücher gewickelt und mit Blumen und Mantras gesegnet.
Während der Körper im Feuer vergeht, rezitieren Priester und Angehörige Verse aus den Veden. Feuer gilt als Mund des Gottes Agni, durch den die Opfergaben (hier: der Körper) zu den Göttern gelangen. Nach vollständiger Verbrennung werden die verbleibenden Knochenfragmente zu Asche zermörsert und meist in einen heiligen Fluss gestreut – idealerweise in den Ganges.
Dieses Aschestreuen symbolisiert die Rückführung der materiellen Elemente zur Natur (Erde, Wasser usw.), während die Seele bereits auf dem Weg in die nächste Welt ist.
Spirituell erwarten Hindus, dass die Seele nach dem Tod zunächst eine Zeit in einer Zwischenebene verweilt, dann aber entweder in einen neuen Körper wiedergeboren wird (Samsara) oder, im besten Fall, aus dem Kreislauf der Wiedergeburten erlöst wird.
Gerade der Tod in der heiligen Stadt Varanasi und die Verbrennung dort gelten vielen Hindus als besonderer Segen: Man glaubt, wer in Varanasi verbrannt und seine Asche dem Ganges übergeben wird, dem wird Moksha (endgültige Erlösung aus Samsara) gewährt.
Aus diesem Grund brennen an den Ghats3 von Varanasi Tag und Nacht Scheiterhaufen – ein eindrucksvolles Sinnbild dafür, wie eng im Hinduismus Feuer, Tod und spirituelle Befreiung verknüpft sind.
Interessanterweise kennt der Hinduismus auch Ausnahmen: Einige wenige Verstorbene werden nicht verbrannt – zum Beispiel sehr kleine Kinder (die als unschuldig gelten) oder verehrte Heilige/Gurus. In solchen Fällen wird eine Erdbestattung oder eine Bestattung im Wasser vorgenommen.
Dies sind jedoch Sonderfälle. Für die große Mehrheit der Hindus bleibt die Feuerbestattung die spirituell richtige Wahl. Es heißt, ein nicht kremierter Körper könnte die Seele länger an die Erdebene binden, während das Feuer sie schneller gen Himmel aufsteigen lässt.
Dieses Bild vom aufsteigenden Rauch, der die Seele zum Himmel trägt, hat im Hinduismus eine tröstliche Bedeutung: Der Tod wird als Befreiung gesehen, nicht als Ende – und das Feuer ist das Tor, durch das die Seele schreitet.

Buddhismus: Vergänglichkeit des Körpers und Loslösung des Geistes
Der Buddhismus lehrt, dass alles Zusammengesetzte vergänglich ist – dies gilt auch für den menschlichen Körper. Tod bedeutet im buddhistischen Verständnis keinen endgültigen Schluss, sondern einen Übergang: Das Bewusstsein (oder Geistprinzip) verlässt den derzeitigen Körper und bewegt sich auf die nächste Daseinsform zu, entsprechend dem Karma.
In vielen buddhistischen Kulturen ist die Feuerbestattung daher üblich, da sie symbolisch die Vergänglichkeit des Körpers unterstreicht und dem Geist erlaubt, sich rascher vom alten Leib zu lösen.
Ein oft genannter Grund: Kremation “befreit die Seele aus ihrer irdischen Form”, wodurch sie schneller voranschreiten kann in Richtung Wiedergeburt oder – im Idealfall – Nirwana/Erleuchtung.
Schon der historische Buddha wurde der Legende nach kremiert – seine Reliquien (Knochenfragmente) verteilte man auf acht Stupas. Dieses Vorbild prägte die buddhistischen Bestattungsbräuche. Besonders in Regionen wie Thailand, Sri Lanka, Japan und Tibet ist das Verbrennen üblich. Allerdings gibt es regionale Unterschiede:
- In Theravada-buddhistischen Ländern (zum Beispiel Thailand, Birma) wird in der Regel unmittelbar nach dem Tod mit den Totenriten begonnen, aber manchmal wartet man einige Tage, bevor der Körper eingeäschert wird. Während dieser Tage wird am aufgebahrten Körper gebetet und verdienstvolles Karma gesammelt (etwa durch Spenden im Namen des bzw. der Verstorbenen), um dem Bewusstsein einen guten Übergang zu ermöglichen.
Man glaubt, die Wiedergeburt erfolge zum Teil sehr schnell – teils sogar unmittelbar – doch sicher ist man sich nicht, wann genau das Bewusstsein den Körper endgültig verlassen hat. Daher schadet es nicht, ein paar Tage mit der Verbrennung zu warten, um auf Nummer sicher zu gehen. - Im Mahayana-Buddhismus (China, Japan, Korea) war zwar historisch auch die Erdbestattung bekannt, doch heute ist die Kremation verbreitet. In Japan beispielsweise werden nahezu 100 % aller Verstorbenen kremiert – dort folgt meist am zweiten oder dritten Tag nach dem Tod die Einäscherung.
Interessant: In Japan wird die Asche anschließend in einer feierlichen Zeremonie von den Angehörigen in eine Urne überführt, indem sie mit Essstäbchen Knochenstücke aus der Asche sammeln. Das Bewusstsein des Toten, so der Glaube, durchläuft währenddessen bereits die erste Phase des 49-tägigen Zwischenzustands (Bardo), bevor es weiterwandert. - Eine Ausnahme bildet das Vajrayana in Tibet, wo neben Feuerbestattungen auch die berühmte Himmelsbestattung praktiziert wird. Dabei wird der Körper in der freien Natur den Geiern überlassen.
Aus buddhistischer Sicht ist dies gleichwertig: Ob der Körper durch Feuer, Erde oder Tiere zurück in die Elemente geht, ist letztlich egal – wichtig ist, dass der Geist losgelöst weiterziehen kann.
Zusammengefasst betrachten Buddhist*innen den Leichnam als leere Hülle. In vielen Strömungen hat sich die Einäscherung durchgesetzt, weil sie praktisch (Platz sparend, hygienisch) ist und spirituell das Loslassen erleichtert.
Es heißt, das Element Feuer transformiere den Körper schnell in reinen Rauch und Asche, während bei der Erdbestattung der Prozess langsamer ist – doch das Endergebnis ist das gleiche: die fünf Elemente (Erde, Wasser, Feuer, Luft, Raum) kehren zurück und das Bewusstsein ist frei.
Wichtig zu erwähnen: Im Moment des Todes und kurz danach werden in allen buddhistischen Traditionen Gebete, Mantras und Meditationen durchgeführt, um dem bzw. der Verstorbenen einen friedlichen Geisteszustand zu vermitteln. Ob verbrannt oder nicht, dieser Geistesfrieden gilt als entscheidend für das Schicksal im nächsten Leben.

Esoterik: Edgar Cayce sowie weitere esoterische Lehrer
Neben den etablierten Religionen gibt es spirituelle Lehrer und Medien, die spannende Einsichten zur Frage Feuerbestattung vs. Erdbestattung geliefert haben. Einer der bekanntesten davon ist Edgar Cayce. Cayce gab in Trancezuständen tausende Readings zu spirituellen und lebenspraktischen Fragen – darunter auch welche zum Tod und Jenseits.
Edgar Cayce zum Thema Feuerbestattung
Interessanterweise äußerte sich Cayce positiv über die Feuerbestattung. In einem Reading nannte er die Verbrennung “die beste Art der Beseitigung des Körpers – im Interesse aller”.
Diese Aussage impliziert, dass Cayce keine spirituellen Nachteile in der Kremation sah – im Gegenteil, er schien zu denken, dass das schnelle Zurückführen des Körpers in die Elemente (durch Feuer) im Einklang mit der Natur und der geistigen Ordnung steht.
Er betonte auch, dass der physische Körper nur Materie ist und nicht das eigentliche Bewusstsein: Auf die provokante Frage “Spürt ein Körper das, wenn er verbrannt wird?” antwortete Cayce: “Welcher Körper? Der physische Körper ist nicht das Bewusstsein.”.
Damit wollte er sagen, dass die Seele bzw. das Bewusstsein vom Moment des Todes an bereits einen anderen Zustand annimmt. Was mit der zurückbleibenden Materie geschieht – ob sie nun langsam verfault oder schnell verbrennt – sei für das eigentliche Ich (die Seele) nicht von Bedeutung. “Man kann den Verstand (Mind) nicht verbrennen”, stellte Cayce klar.
Allerdings liefern Cayces Readings auch Nuancen: So meinte er, wie lange eine Person nach dem Tod noch einen Bezug zum physischen Körper hat, hänge vom Individuum ab – speziell von dessen materiellen Bindungen und Begierden.
Manche Seelen realisieren demnach ihren Tod nicht sofort und “halten sich noch in Erdnähe auf”. Für solche Fälle sprach Cayce eine Warnung aus: In einem Reading riet er davon ab, eine bestimmte Person direkt nach dem Tod zu kremieren, “da noch nicht genügend von den elementaren Kräften getrennt” sei (sprich: die feinstofflichen Verbindungen zum Körper seien noch zu stark).
Cayce empfahl vielmehr, zu warten, bis die Seele sich vollständig gelöst hat.
Interessanterweise deckt sich das mit alten Traditionen, die eine Dreitagefrist einhielten, bevor ein Leichnam dem Feuer übergeben wurde.
Cayce selbst nannte als Faustregel: Je stärker die materiellen Wünsche und weltlichen Neigungen eines Menschen waren, desto länger kann es dauern, bis das Bewusstsein nach dem Tod vollkommen vom Körper abgezogen ist.
Dennoch bleibt seine Kernbotschaft optimistisch: Sobald die Seele “abwesend vom Körper” ist, ist sie bei Gott – “Abwesend vom Körper, gegenwärtig beim Herrn”, wie Cayce unter Verweis auf die Bibel formulierte. Ab diesem Punkt, so Cayce, fühlt der Körper nichts mehr.
Weitere esoterische Lehrer zur Bestattungsform
Zusätzlich zu Cayce lohnt ein Blick auf andere Medien und esoterische Lehrer: Viele Spiritisten (etwa im 19./20. Jahrhundert) teilten die Ansicht, dass die Seele den physischen Tod überdauert und relativ schnell in eine jenseitige Sphäre wechselt.
Berichte von Medien sprechen manchmal davon, dass Verstorbene überrascht waren, ihren eigenen Körper zu sehen. Einige wenige Jenseitskontakte behaupten sogar, hastige Feuerbestattungen könnten ein verwirrtes Bewusstsein kurzzeitig erschrecken.
Chico Xavier
So gibt es Schilderungen (zum Beispiel in der brasilianischen Spiritisten-Tradition um Chico Xavier), wo verstorbene Geister erzählten, sie hätten einen “Schock” gespürt, als ihr Körper zu früh eingeäschert wurde, weil sie sich noch nicht ganz gelöst hatten.
Der bekannte brasilianische Chico Xavier selbst empfahl daher, idealerweise 72 Stunden zu warten, bevor man eine Feuerbestattung vornimmt, um letzte “Echos der Sensibilität” zwischen Körper und Seele verklingen zu lassen.
Rudolf Steiner
Auch Rudolf Steiner, Begründer der Anthroposophie, lehrte, dass es etwa drei Tage dauert, bis sich der Ätherleib mit all den Lebenskräften vom physischen Leib getrennt hat. In dieser Zeit durchlebt die Seele nach Steiner einen Rückblick auf das vergangene Leben.
Steiner betrachtete die Feuerbestattung zwar grundsätzlich als der Erdbestattung gleichwertig, empfahl aber in bestimmten Fällen – etwa bei Suizid – eher eine Erdbestattung, um der geplagten Seele mehr Ruhezeit zu geben.
Zudem gab er zu bedenken, dass das vorschnelle Verstreuen von Asche in Wind oder Wasser problematisch sein könne: In einer mündlich überlieferten Aussage nannte Steiner das Verstreuen der Asche “etwas Schreckliches” – die Seele würde sich dabei “wie zerrissen” fühlen.
Deshalb solle man zumindest die Asche an einem Ort zur Ruhe betten (Urnenbeisetzung), statt sie wahllos zu verstreuen.

Was bedeutet das für unsere letzte Reise?
Unsere Reise durch die Religionen und spirituellen Lehren zeigt: Aus Sicht der Seele kommt es weniger auf die Methode der Bestattung an, sondern darauf, wie wir das Loslassen gestalten.
In praktisch allen Traditionen – ob Ost oder West, orthodox oder esoterisch – findet sich der Gedanke, dass die Seele den Körper überdauert. Viele glauben, sie fühlt keinen Schmerz, sobald der irdische Leib tot ist. Wissenschaftlich betrachtet gibt es ohnehin keinen Hinweis, dass eine immaterielle Seele vom Feuer verletzt würde; und aus medizinischer Sicht endet mit dem Hirntod auch jegliches Schmerzempfinden im Körper.
Die Unterschiede liegen vor allem in den Ritualen und Symbolen: Für einige Religionen ist die Erdbestattung heilig, weil sie Tradition, Respekt und Auferstehungshoffnung ausdrückt. Für andere (besonders östliche Religionen) ist die Feuerbestattung ein Akt der Reintegration in den Kreislauf der Natur und des Geistes.
Spirituell Konsequenzen im Sinne von Lohn oder Strafe hat die gewählte Methode demnach nicht – wohl aber kann sie den Hinterbliebenen und der Kultur wichtig sein.
Eine Seele “verübelt” es uns nicht, ob wir sie verbrennen oder begraben; viel bedeutsamer ist, dass wir es mit Liebe, Achtung und gemäß ihrem Wunsch tun.
So empfiehlt es sich für Angehörige, die Entscheidung pro Feuer oder Erde nach folgenden Kriterien zu treffen (ähnlich wie es der oben erwähnte Kompromissvorschlag formuliert):
- Glaube und Wille des Verstorbenen: Hatte die Person zu Lebzeiten klare Vorstellungen? Folgt man einer Religion mit festen Vorgaben (zum Beispiel Islam, Orthodoxie), oder ist man frei in der Wahl?
- Intuition und Respekt: Fühlt es sich richtig an, den Körper zu verbrennen, oder eher ihn der Erde zu übergeben? Was gibt der Familie mehr Frieden im Herzen?
- Praktische Umstände: Kosten, Friedhofsverfügbarkeit, Umweltaspekte können mitbedacht werden – jedoch sollte die Würde immer über rein pragmatische Vorteile gestellt werden.
Falls eine Feuerbestattung gewählt wird und man dennoch ein mulmiges Gefühl bezüglich der “Seelen-Frage” hat, kann man folgendes beherzigen (aus spiritueller Sicht): Ein bis drei Tage den Körper ruhen lassen (bei kühler Lagerung), bevor er kremiert wird.
Nutzen Sie diese Zeit für Rituale des Abschieds – sei es ein Gebet nach jeweiligem Glauben, das Anzünden einer Kerze, das Verbrennen von Weihrauch oder das Sprechen guter Wünsche an die Seele. Auf diese Weise schafft man einen Raum, in dem sich der Geist lösen kann.
Ist diese Frist vorbei, darf man im Vertrauen loslassen. Viele Spirituelle sind überzeugt: Die Seele geht ihren Weg ins Licht, egal ob wir ihren Körper dem Feuer überantworten oder der Erde. Entscheidend sind die Liebe und der Respekt, mit dem wir diesen letzten Akt vollziehen.
Am Ende bleibt der Trost, den fast alle Traditionen kennen: “Von der Erde sind wir gekommen, und zu Erde (oder Asche) werden wir wieder – doch die Seele kehrt heim in die geistige Welt.”
Christliche Spiritualität
Buddhistische Spiritualität
Spiritualität und Esoterik
- Tahara bezeichnet im jüdischen Bestattungswesen die rituelle Reinigung und Vorbereitung des Leichnams. Es handelt sich um eine feierliche Waschung, bei der der Körper respektvoll gereinigt, in Leinentücher gehüllt und mit Gebeten begleitet wird, bevor er in den Sarg oder direkt in die Erde gelegt wird.
Die Tahara wird von speziell geschulten Mitgliedern der Gemeinde (Chevra Kadischa – „Heilige Bruderschaft“) durchgeführt und gilt als ein Akt größter Barmherzigkeit gegenüber dem bzw. der Verstorbenen. ↩︎ - Halacha (hebräisch „der Weg“) bezeichnet das jüdische Religionsgesetz, also die Gesamtheit aller verbindlichen Gebote, Vorschriften und rabbinischen Auslegungen, die das religiöse und alltägliche Leben im Judentum regeln. ↩︎
- Ghats sind die Treppenanlagen am Ufer des Ganges in Varanasi (Indien), die vom Stadtgebiet hinunter zum Fluss führen. Sie dienen als religiöse Zugänge zum Heiligen Fluss und werden von Hindus für rituelle Badezeremonien, Gebete, Feueropfer – und an bestimmten Ghats auch für Einäscherungen genutzt. ↩︎